Vom Badehaus zum Schlösschen
Ein Beitrag der Geschichtswerkstatt Ettlingen von Werner Leibold

Aufnahme des Schlösschen bzw. Villa Wackher an der Pforzheimer Straße 2023, Quelle: Familie Leibold
Es war noch etwas Geld übrig, offensichtlich! Neun Jahre nach der Gründung Karlsruhes 1715 erteilt Karl Wilhelm, Markgraf von Baden-Durlach, den Auftrag zum Bau einer Badeanlage in Langensteinbach, mit der Kutsche nur etwa zwei Stunden von seiner neuen Residenz entfernt. Er sollte nicht sehr lange profitieren können vom heilkräftigen Quellwasser unterhalb der Barbara-Kapelle, vom angenehmeren Klima auf den Höhen über dem Rheintal. Nach seinem Tod 1738 waren es seine Familie und seine Nachfolger, die bis 1832 das Bad als Sommerresidenz nutzten, aber auch den Niedergang des Bades miterleben mussten. Mangelnde Modernisierung an der Anlage und die erwachende Konkurrenz in Baden-Baden ließen das Interesse am Kurfürstenbad in Langensteinbach schwinden. Die Großherzogliche Domänenverwaltung versteigerte die Anlage schließlich im Jahre 1832,[i] zwei Pforzheimer Kaufleute, Rudolf Deimling und Gottfried Mayer erhielten den Zuschlag.[ii] Dass der Vertreter der versteigernden Domänenverwaltung ebenfalls Deimling hieß: „ein Schuft, der Böses dabei denkt“.
Mit Gottfried Mayer tritt der Hauptakteur auf die Bühne unserer Geschichte, der Entstehungsgeschichte eines Ettlinger Gebäudes, ziemlich unauffällig linker Hand an der Pforzheimer Straße in Ettlingen stehend, wenn man die Stadt Richtung Albtal verlässt.

Ausschnitt aus Google Maps mit dem entsprechenden markierten Gebäude, Quelle: Google Maps
Als Erster ist es Edmund Sander, der 1912 in seinem Büchlein über „Langensteinbach das einstige Kurfürstenbad“[iii] davon schreibt, dass ein Teil dieser Badeanlage nach Ettlingen verbracht worden sei und „heute noch als Wohnhaus zwischen dem Gute Watthalden und der Spinnerei auf der Bergseite“ stehe. Spätere Publikationen, L. Bopp in „Sagen und Geschichten aus Ettlingen und dem Albgau“ 1931 und H. Schneider-Strittmatter in „Langensteinbach - Das ehemalige Fürstenbad“ (um 1970) wiederholen diese Behauptung. Nur: Belege dafür legen auch sie nicht vor!
Begeben wir uns also auf die Suche nach Beweisen für diese These und versuchen, die Geschichte dieses Gebäudes nachzuerleben, das wir in Zukunft „Schlösschen“ nennen wollen. Die alten Ettlinger kennen es als die „Villa Wackher“, untrennbar verbunden mit dem Namen eines der ältesten Ettlinger Industriebetriebe, der „Ettlinger Bleiche“, Carl Wackher & Sohn, heute firmierend als „Wackher Textilveredelung GmbH“.
Gottfried Mayer hat also Ende 1832 die kurfürstliche Badanlage in Langensteinbach zusammen mit R. Deimling erworben und sie eröffnen darin, firmierend als „Deimling u. Mayer“ Anfang 1833 eine Bleicherei[iv], die ein Jahr darauf von Gottfried Mayer „allein und auf eigene Rechnung“ weiterbetrieben wird.[v] Um für sein Engagement in Langensteinbach „flüssig“ zu sein, bietet Deimling zuvor sein Warenlager in Pforzheim zum Verkauf an und ist auch durchaus geneigt, sein dazugehöriges Geschäft zu veräußern.[vi]
In den folgenden Jahren scheint Mayers „Naturbleiche zu Langensteinbach“ ganz gut zu laufen. Landauf landab werben „Außendienstler“ alljährlich im Frühjahr um Aufträge für die Bleiche, die Liste der Annahmestellen reicht von Mosbach über Heidelberg und Karlsruhe bis Freiburg und Donaueschingen.[vii] Karl Wackher steht nicht auf der Liste, aber auch er wirbt 1842 und noch 1845 um Aufträge für die Bleiche in Langensteinbach, in der gleichen Art und Weise wie die anderen Agenten.[viii]
Gegen Ende der 1840er gehen die Geschäfte für Mayer wohl nicht mehr so gut, er wird „in Gant“, d.h. für Konkurs erklärt. Aus seiner Habe werden 1850 ein einstöckiges Wohnhaus in Langensteinbach und 20 Morgen Wiesengelände versteigert.[ix] Die Badanlage bleibt mitsamt der zwischenzeitlich dort für den Bleichereibetrieb errichteten Nebengebäude offensichtlich weiter in seinem Besitz.
Zwischenzeitlich legt Karl Wackher 1838 in Ettlingen mit dem Kauf der „Schmidtschen Schleifmühle“ den „offiziellen“ Grundstein für den Beginn der „Ettlinger Bleiche“[x] und erwirbt in den Folgejahren zusammen mit seinem Bruder Ludwig („Louis“) zahlreiche Grundstücke hinzu.[xi]
1846 und 1847 wird auch Gottfried Mayer in Ettlingen auf dem Grundstücksmarkt aktiv und erwirbt insgesamt acht Grundstücke, meist Rebengrundstücke „im Watt“, an die „Wattstraße“ (die heutige Pforzheimer Straße) angrenzend.[xii] („Watt“ ist in Ettlingen der Talgrund eingangs des Albtals. Das Gewann reicht aber auch nördlich der Pforzheimer Straße ein Stück den Robberg hinauf. „Wattkopf“ und „Watthalden“ zeugen davon.) Die Anzahl der erworbenen Grundstücke und die jetzige Kontur des Grundstücks lassen durchaus erkennen, dass mit diesen Käufen das Baugrundstück entstanden ist.[xiii] Ob Mayer sich mit den Käufen in Ettlingen übernommen hat? Wir wissen es nicht. Die Versteigerung eines Teiles seines Eigentums in Langensteinbach im Jahre 1950 lässt diesen Schluss allerdings zu, hat er doch auch für das letzte Grundstück 1847 nur eine Anzahlung von 30 Gulden geleistet und die restlichen 300 Gulden „als verzinsliches Kapital“ stehen lassen.[xiv]

Plan der Stadtwerke Ettlingen aus dem Jahr 1906, Quelle: Stadtarchiv Ettlingen

Ausschnitt aus dem Bodenrichtwertsystem „BORIS“, Quelle: BORIS
Ein Plan der Stadtwerke Ettlingen aus 1906[xv], hier ein Ausschnitt, zeigt die gleiche Geometrie des Grundstücks, wie sie heute aus dem Bodenrichtwertsystem „BORIS“ des Landes Baden-Württemberg abzulesen ist. Die acht streifenförmigen Teilflächen passen zu den acht Käufen Mayers 1846 und 1847. (Gestrichelte Linien vom Verfasser ergänzt)
Wir wissen nicht, was auf dem Grundstück ab 1847 passiert ist. Baugesuche, Ausschreibungen von Bauarbeiten oder Anderes, was auf eine Bautätigkeit hätte schließen lassen, konnten nicht aufgefunden werden.
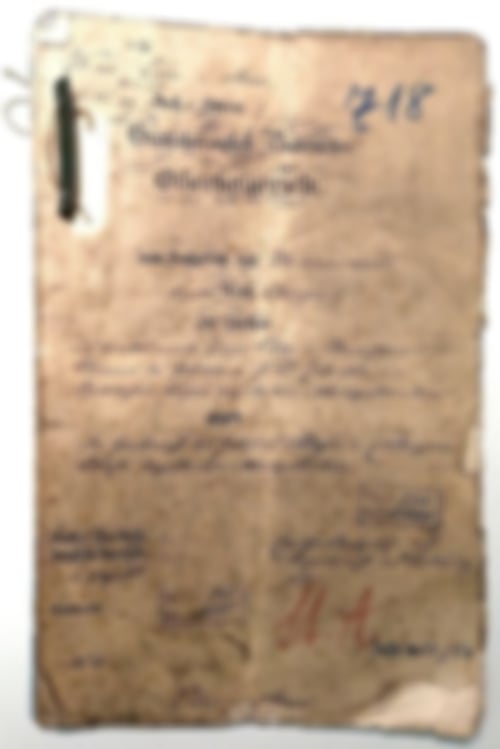
Deckblatt einer Akte die sich mit dem Gebäude befasst aus dem Jahr 1853-1856, Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe
Manche Texte nennen (wieder ohne Quellen-angabe) 1849 als das Sterbejahr Mayers. In den Kirchenbücher Ettlingens war nichts darüber zu finden. Jedenfalls klagt 1853 der Mannheimer Versicherungsagent Thomas Eller „Namens des Partikulärs J.D. Zutt“ in einem Verfahren bis in die dritte Instanz vor dem Großherzoglich Badischen Oberhofgericht in Mannheim „gegen die Gantmasse des Gottfried Mayer in Ettlingen“ wegen „Eigenthumsansprüche mit Separatsrecht und Forderung“.[xvi] Sein Mandant möchte offensichtlich bevorzugt aus der Gantmasse (d.h. Konkursmasse) befriedigt werden, gleichermaßen Karl Wacker und andere, die im Verfahren dem die Klage vertretenden Anwalt Vertretungsvollmacht erteilt hatten.[xvii] Der Anwalt heißt (zufälligerweise?) auch Eller.
Drei Jahre später, im November 1856, stellt der Großherzogliche Vollstreckungsbeamte, Notar Schilling aus Ettlingen, eine Annonce ins Großherzoglichen Anzeigeblatt, nach der er infolge richterliche Verfügung aus der Gantmasse des verstorbenen Kaufmanns Mayer Anfangs Dezember versteigern wird.[xviii] Die Aufzählung der Versteigerungspositionen umfasst erstens (zu einem Schätzungspreis von 5.500 Gulden) „ein zweistöckiges, an der Pforzheimer Straße gelegenes Wohnhaus mit zwei einstöckigen Anbäuen“ sowie zweitens eine Anzahl von „zum Betrieb der Bleiche“ „auf dem Grund und Boden … Wackher befindliche Gebäulichkeiten“ die „zum Abbruch bestimmt“ sind. Das Zweite lässt den Schluss zu, dass in den Jahren zuvor im Besitz Mayers befindliche Bleicherei-Nebengebäude von Langensteinbach nach Ettlingen verbracht und dort auf Wackherschen Grundstücken wieder errichtet worden waren. Ob und in welcher Intensität dort gebleicht wurde ist nicht bekannt. Am 6. März 1857 übersendet der Vollstreckungsbeamte Notar Schilling dem Ettlinger Gemeinderat einen „Auszug mit dem Steigerungsprotokoll über die Liegenschaftsversteigerung zur Gantmasse des verstorbenen Bleichinhabers Gottfried Mayer von hier“. Demnach „hat bey der Steigerung vom 20. Dezember 1856: Herr Kaufmann Karl Wackher von hier: Ein 2stöckiges Wohnhaus mit zwei einstöckigen Anbäuen, Stallung und Remise … an der Pforzheimerstraße, neben Josef Dillmann Wittum und Andreas Berger für 3210 f.“ ersteigert.[xix] Wir kennen diese Beschreibung bereits Wort für Wort aus der Ankündigung der Versteigerung. Es konnten also am ersten Versteigerungstermin vom 5. Dezember nicht die taxierten Summen erreicht werden und es musste ein neuer Termin auf den 20. Dezember 1856 angesetzt werden, bei dem die Veranschlagungen keine Rolle mehr spielten. Der oben genannte Betrag von 3.210 Gulden ist gegenüber dem Anschlag von 5.500 Gulden nur vordergründig ein „Schnäppchen“. Laut demselben Grundbucheintrag lastete auf dem Anwesen bereits eine Pfandlast von 6.600 Gulden, allerdings zugunsten Karl Wackers selbst! Seit dem 6. März 1857 ist Karl Wackher also Eigentümer des Schlösschens, die Ära Mayer war zu Ende.

Ausschnitt des Kurfürstenbades zu Langensteinbach, dass das Schlösschen zeigen könnte, Quelle: Stadtarchiv Ettlingen
Nachdem letztmals 1850 für die Langensteinbacher Bleiche um Aufträge geworben worden war,[xx] erscheinen 1858 die ersten Werbeanzeigen für die „Naturbleiche von Karl Wackher zu Ettlingen, welche ganz neu und aufs Zweckmäßigste eingerichtet ist.“[xxi] Karl Wackher I hatte nämlich seinen Sohn (Karl W. II) nach dessen Studiums des Maschinenbaus an der Technischen Hochschule in Karlsruhe nach England und Schottland geschickt, damit er dort praktische Erfahrung sammeln konnte. Neben den Erfahrungen brachte Karl Wackher II von dort auch die neuesten Techniken und aktuellsten Maschinen nach Ettlingen.
Bis Mitte der 1980er Jahre war die Familie Wackher damit ohne Unterbrechungen Eigentümer des Schlösschens. Im Zuge der Trennung von einem langjährigen Teilhaber an der Firma ging das Schlösschen an Richard Peter über und später an dessen Tochter Irene, bevor es schließlich im Jahr 2000 an die jetzigen Besitzer verkauft wurde.
Im Verlauf der anschließenden Modernisierungsarbeiten wurden seitens des Denkmalsamtes restauratorische Gutachten beauftragt, die zwar einige wenige Ausbauelemente, wie z. B. Türbeschläge, in eine Zeit vor 1840 datierten, aber keine Beweise für deren Ursprung in Langensteinbach finden konnten.[xxii] Auch eine Masterarbeit, die am KIT in Karlsruhe 2015 angefertigt wurde, schließt mit der Feststellung, dass für ein Verbringen von Gebäudeteilen des Bades Langensteinbach nach Ettlingen keine Belege gefunden werden konnten.[xxiii] Allerdings ermöglichen die um 2001 an Hand eines Aufmaßes angefertigten Pläne des Gebäudes[xxiv] einen Vergleich der heutigen Geometrie des Gebäudes mit den bei der 1833er Versteigerung des Bades angegebenen Abmessungen: Länge und Tiefe des Mittelbaus stimmen überein, ebenso wie die Tiefe der Seitenflügel. Nur deren Länge ist erheblich geringer. Die große straßenseitige Gaupe im Mitteltrakt stammt aus dem Jahr 1926, als die Familie Wackher im Dachgeschoss zusätzliche Zimmer einrichten ließ.[xxv] Danach waren es nur noch kleinere Maßnahmen wie die Reparatur eines Schornsteins, die den Weg in die Akten des Bauordnungsamtes gefunden hatten.[xxvi]
So bleibt uns, wenn wir mit schlüssigen Beweisen Gewissheit über die materielle Herkunft des Schlösschens erreichen wollen, nur die weitere Suche
z.B.: nach Baugesuch und Baugenehmigung
nach Verträgen und Abrechnungen mit beteiligten Fuhr- und Bauunternehmen
nach Beweisen für eine frühere Verwendung des Bruchsteinmauerwerks.
Insbesondere aber könnte mit den Methoden der Dendrochronologie das Jahr der Fällung der Bäume ermittelt werden, aus denen die im Schlösschen verbauten Dach- und Deckenbalken gesägt worden waren. Dann hätten wir wohl endlich die Gewissheit, auf deren Suche wir uns vor nunmehr drei Monaten begeben hatten.
Bei dieser Suche halfen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der verschiedenen Behörden und Institutionen und Firmen, die in der einen oder anderen Art mit dem Gebäude einmal „zu tun“ hatten. Mühsam war es, die vielen in Kurrentschrift von unterschiedlichen Verfassern handgeschriebenen Seiten aus Grundbüchern und Gerichtsakten zu entziffern. Der gesetzliche Datenschutz, so wichtig er ist, war die erwartete Bremse bei den Recherchen. Die elektronische Datenverarbeitung, bis hin zu Anwendungen der künstlichen Intelligenz wie Chat-GPT, hat dabei nicht nennenswert geholfen. Auf unsere Recherche angewendet war das erhellend:
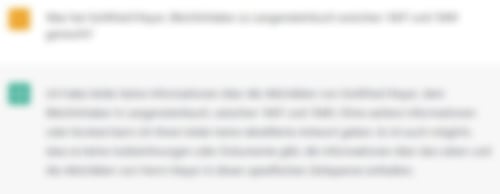
Antwort der Software Chat GPT aus dem Jahr 2023, Quelle: Chat GPT
Mit anderen Worten: „Ich habe keine Ahnung, dieses aber hübsch formuliert“. Das menschliche Gehirn hat sich (noch) als effektiver erwiesen. Es wäre allerdings interessant zu verfolgen, ob und wie diese Software nach der Publikation dieser Arbeit dazulernt.
ein Artikel von Werner Leibold, März 2023
Die in den folgenden Endnoten zitierten Zeitungen konnten durchweg „online“ bei der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe eingesehen werden.
Quellenangaben
[i] Karlsruher Zeitung v. 23.03.1832
[ii] Durlacher Wochenblatt v. 27.01.1833
[iii] Im Stadtarchiv Ettlingen, Dienstbibliothek
[iv] z.B. Karlsruher Intelligenz- und Tageblatt v. 05.03.1833, S. 219
[v] Durlacher Wochenblatt v. 16.03.1834
[vi] Der Beobachter v. 20.10.1832, S. 540
[vii] Karlsruher Zeitung v. 20.04.1833, S. 929
[viii] Wochenblatt für die Ämter Rastatt, Ettlingen und Gernsbach v. 26.03.1845
[ix] Durlacher Wochenblatt v. 13.05.1850, S. 147
[x] In Festschrift der Firma 1963
[xi] Grundbücher Ettlingen 1846 u. 1847
[xii] ebenda
[xiii] BORIS, Bodenrichtwertsystem f. Bad.-Württ. für Flst. 1630
[xiv] Grundbuch Ettlingen v. 1847, S. 377 u. 378
[xv] Stadtwerke Ettlingen, Lageplan Nr. 4 über die Wasserleitung Ettlingen
[xvi] Gerichtsakte im Generallandesarchiv Karlsruhe, Nr. 240-4085
[xvii] ebenda auf S. 37
[xviii] Großherzogl. Badisches allgemeines Anzeigeblatt v. 14.11.1856
[xix] Grundbuch Ettlingen 3 GB-019, S. 250-251
[xx] Karlsruhe Tagblatt v. 20.02.1850, S. 251
[xxi] z.B. Ortenauer Bote v. 09.04.1858, S. 218
[xxii] U. F. Schlee, Restauratorische Untersuchungen (im Auftrag des Denkmalamts)
[xxiii] S. Thiele-Bergmann, „Das ehemalige Fürstenbad in Langensteinbach, Masterarbeit am Institut für Kunst- und Baugeschichte, KIT Karlsruhe
[xxiv] Architekturbüro Essari, Karlsruhe, um 2001
[xxv] Architekturbüro Schottmüller, Ettlingen, 1926 (im Archiv des Bauordnungsamtes)
[xxvi] Baugesuch Irene Peter, 1987 (im Archiv des Bauordnungsamtes)

